Die Korrektur von Klassenarbeiten und Klausuren gehört zu den zeitintensivsten Aufgaben im Lehreralltag. Mit dem Einzug von Künstlicher Intelligenz in der Bildung stellt sich die Frage: Werden Lehrkräfte bald durch Algorithmen entlastet – oder geht dabei etwas verloren, das pädagogisch unverzichtbar ist?
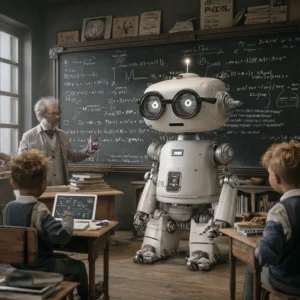
Erste Ansätze: KI korrigiert Klausuren
Thüringens Bildungsminister Christian Tischner (CDU) verweist auf ein beeindruckendes Beispiel aus dem Wettbewerb Jugend forscht. Dort entwickelten Schüler eine Software, die Fehler automatisch erkennt, Noten vorschlägt und Lernangebote erstellt. Ein Projekt, das zeigt, wie weit Künstliche Intelligenz in der Bildung bereits fortgeschritten ist.
Auch Plattformen wie Fobizz testen bereits praxistaugliche Lösungen. Lehrkräfte laden Fotos von Arbeiten hoch, die durch Schrifterkennung in Text umgewandelt werden. Anschließend erstellt die KI auf Basis von Musterlösungen eine Bewertung: Sie erkennt Stärken, weist auf Lücken hin und gibt eine Punktzahl aus – die Lehrkraft behält aber das letzte Wort.
Forschungsprojekte: KI-Exam und DeepWrite
Mit Hochdruck arbeiten auch Wissenschaft und Forschung an Lösungen für komplexe Aufgabenstellungen.
- KI-Exam, gefördert vom Bundesforschungsministerium, soll Lehrkräfte bei der Bewertung offener Freitextaufgaben unterstützen. Die KI sortiert Antworten in Cluster, vergleicht sie mit Musterlösungen und erleichtert so die Korrektur.
- DeepWrite an der Universität Passau entwickelt ein Tool für juristische Klausuren. Es spiegelt den klassischen Gutachtenstil wider und gibt Studierenden automatisiertes Feedback – etwas, das in Massenveranstaltungen sonst kaum möglich wäre.
Beide Projekte zeigen: Künstliche Intelligenz in der Bildung kann Prozesse beschleunigen und objektiver machen. Doch sie offenbaren auch Grenzen – etwa bei schwer lesbaren Handschriften, kreativen Antworten oder der Frage, wie pädagogische Feinfühligkeit in Feedback integriert werden kann.
Grenzen und rechtliche Hürden
So groß die Chancen sind, so klar sind auch die Risiken. Lehrkräfte befürchten den Verlust des persönlichen Elements in der Rückmeldung. Gerade Kommentare am Rand einer Arbeit oder mündliche Erläuterungen sind für Lernende oft besonders wertvoll.
Zudem gibt es rechtliche Vorgaben: Die seit 2024 geltende EU-Verordnung stuft Bildung als Hochrisikobereich für Künstliche Intelligenz ein. Der alleinige Einsatz von KI bei offiziellen Prüfungen – etwa im Staatsexamen – gilt daher als problematisch.
Fluch und Segen zugleich
Bildungsminister Tischner beschreibt den Einsatz von KI in der Bildung als „Fluch und Segen zugleich“. Einerseits entlastet die Technologie Lehrkräfte und eröffnet neue Lernmöglichkeiten. Andererseits erfordert sie mehr Kontrolle, etwa bei Hausarbeiten, die zu Hause verfasst werden. Mündliche Prüfungen könnten dadurch wieder an Bedeutung gewinnen.
Fazit: Künstliche Intelligenz verändert den Schulalltag
Ob Jugend forscht, Fobizz oder Forschungsprojekte wie KI-Exam und DeepWrite – überall wird daran gearbeitet, die Korrektur von Klausuren zu automatisieren. Vollständig ersetzen wird die Maschine den Menschen jedoch nicht. Vielmehr geht es um eine sinnvolle Kombination: Künstliche Intelligenz übernimmt Routinen, Lehrkräfte behalten die pädagogische Verantwortung.
Damit steht fest: KI in der Bildung wird den Unterricht, die Prüfungskultur und den Lehreralltag nachhaltig verändern. Die Frage ist nicht mehr, ob, sondern wie wir diese Transformation gestalten.